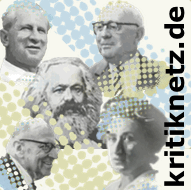Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
Beiträge der kritischen Theorie zur Kritik der Polischen Ökonomie und des Staates
- Details
- Geschrieben von: Meinhardt Creydt
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 6878
Aus verschiedenen Perspektiven wurde und wird gefragt, ob breite Abschnitte des „technologischen Fortschritts“ ihren Preis wert sind. Der französische Autor Claude Bitot greift in die Diskussion über diese Frage so ein, dass er die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung einer Arbeit lenkt, die unter Bedingungen industrieller Produktion große handwerksnahe oder handwerksähnliche Anteile einschließt. Bitot vergegenwärtigt eindrücklich die Folgen, die entstehen, wenn es an solcher Arbeit fehlt. Sie betreffen die Lebensweise, die Alltagskultur und die Psyche.
- Details
- Geschrieben von: Harald Haslbauer
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 6526
Die Arbeitskraft ist eine zentrale Kategorie bei Marx. Vermittelt über den Verkauf der Arbeitskraft im Tausch zwischen Kapital und Arbeiter entäußert sich die Arbeitskraft im Betrieb des Kapitals als Lohnarbeit. In fast allen Lesarten von Marx wird die Qualität der Arbeitskraft nicht näher bestimmt. Was mit ihr wird oder wie sie geäußert wird, ist damit schon nur vage erfasst. Insbesondere ist aber meist nicht eindeutig, wie sie in dem Prozess der Lohnarbeit veräußert wird. Schlussfolgerungen auf das dabei tätige Subjekt ergeben sich überhaupt nicht.
- Details
- Geschrieben von: Joshua Graf
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 7349
Eine Einführung in das Kritikverständnis von Karl Marx
Dass Karl Marx als einer der einflussreichsten Kapitalismuskritiker aller Zeiten gilt, ist unbestritten. Zur Debatte steht, was Marx am Kapitalismus zu kritisieren hatte und wie er dies tat. Entgegen simplizistischer Ansätze ist das Marx`sche Werk keineswegs ein kontinuierlicher Progress, sondern von Brüchen und Widersprüchen gekennzeichnet. Hierzu liefert der Text von Joshua Graf eine erste Einführung.
- Details
- Geschrieben von: Harald Haslbauer
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 2671
Zu Hegels Grundlegung der abstrakten Rechtskategorien im Willen
Beim folgenden Text von Harald Haslbauer handelt es sich um eine immanente Kritik von Hegels epochalem Werk „Grundlinien der Philosophie des Rechts“. In ihm stellt Hegel das Recht als logische Konsequenz des ‚an und für sich freien Willens‘ dar. Haslbauer dagegen zeigt in seiner Kritik im detaillierten Durchgang der Untersuchung Hegels, dass ihm das in keiner Weise schlüssig gelingt.
Allerdings erfasst Hegel nach Haslbauer die elementaren Willens-Kategorien des Rechts, Person und Eigentum in ihren spezifischen Eigenheiten. Damit zeichnet er sehr präzise die Subjekte, ihren Bezug auf die Dinge dieser Welt und ihre eingeschränkten Beziehungen aufeinander in der bürgerlichen Gesellschaft nach. Doch entgegen seiner Intention, das Recht als dem Willen des Menschen gemäß aussehen zu lassen und es als solches zu empfehlen, führt Hegels Philosophie des Rechts am Ende tatsächlich zur Conclusio, dass und wie im Willen zur Freiheit systematisch die Freiheit des Willens als eine des Menschen aufgehoben oder in sich selbst hintertrieben wird. Damit ist Hegel letztlich ein vernichtendes Urteil sowohl zum Recht als auch zur Freiheit im Recht gelungen.
- Details
- Geschrieben von: Frank Kuhne
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 4413
Zum Problem der normativen Grundlage des Kapitals und der Kritischen Theorie
Für eine kritische Theorie der Gesellschaft ist die eigene normative Grundlage problematisch. Der Text skizziert das Problem zunächst anhand eines Vergleichs des von Kant explizierten kategorischen Imperativs mit den so genannten kategorischen Imperativen, die sich bei Marx und Adorno finden. Er zeigt sodann, dass die kritische Theorie des Kapitals entgegen mancher marxschen Äußerung nicht als eine positive materialistische Wissenschaft aufzufassen ist. Sie sperrt sich gegen eine solchen Interpretation. Dieser Sachverhalt kann allerdings nur dann eingesehen werden, wenn zwischen dem „marxschen Denken“ und der Kapitaltheorie unterschieden wird. Das Gros der Interpreten möchte diesen Unterschied nicht machen.
- Details
- Geschrieben von: Helmut Dahmer
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 6126
Am 15. August 2021 zerriss in Afghanistan „der Schleier der kollektiven IIlusion, dass die Oasenbewohner sich die sie umgebende Weltwüste mit Geld und Waffen dauerhaft vom Leib halten könnten und dass die bedeutendste Wirtschafts- und Militärmacht das Wunder zustande bringen werde, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ein rückständiges und von jahrzehntelangen Kriegen verheertes Land mit Hilfe modernster Destruktionsmittel nicht nur dauerhaft zu befrieden, sondern es auch noch zu ‚demokratisieren‘“ (Dahmer). Der zerrissene Schleier bot den Oasenbewohnern die erwünschte Gelegenheit, über die desaströse Oasenpolitik neu nachzudenken und darüber endlich zu Verstande zu kommen.
- Details
- Geschrieben von: Alexander Neupert-Doppler
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 8711
Zur Kritischen Theorie des Staates
Im folgenden Text zieht Alexander Neupert-Doppler drei Lehren aus der kritischen Reflexion der Geschichte des Staates.
So wie, laut Marx, „aller Mystizismus der Warenwelt, all der Zauber und Spuk, welcher Arbeitsprodukte auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet [...] sofort, sobald wir zu anderen Produktionsformen fluchten“ (MEW 23: 81), so würde erstens auch der Rechts-, Politik- und Staatsfetischismus nur verschwinden, wenn die Revolution „die politische Form ihrer sozialen Emanzipation“ (MEW 17: 543) erfindet. Zurückgehend auf die Kritische Theorie bleiben drei Lehren für eine Kritische Theorie des Staates. 1871 konnte Marx für einen Moment glauben, dies wäre in der Form der Pariser Commune gelungen.
- Details
- Geschrieben von: Andreas Stückler
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 9263
Andreas Stückler arbeitet im vorliegenden Beitrag mit einem dialektischen Begriff von „gesellschaftlicher Funktion". Er entwickelt das Konzept einer „dysfunktionalen Funktionalität“, das er exemplarisch an zwei aktuellen gesellschaftlichen Krisentendenzen illustriert: einerseits an der sogenannten „Krise der Arbeit“ durch fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung, andererseits an der ökologischen Problematik (Umweltzerstörung, Klimawandel etc.). Dabei wird versucht zu zeigen, dass beide Tendenzen nur dann hinreichend kritisch analysiert werden können, wenn diese analytisch in den Funktionsstrukturen kapitalistischer Gesellschaften kontextualisiert werden.
- Details
- Geschrieben von: Meinhard Creydt
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 8912
Zentrale Fehler regressiver Kapitalismuskritik
Im folgenden Artikel setzt sich M. Creydt kritisch mit den Vorstellungen von H. J. Krysmanski über das „Imperium der Milliardäre“[1] auseinander. Geprüft wird die Vorstellung, die „Superreichen“ könnten in den führenden westlichen Nationen das ökonomische Geschehen steuern und die Politik „diktieren“ (Krysmanski). Der Verfasser argumentiert, dass es unzureichend sei, das Bewusstsein der Bevölkerung aus „Manipulation“ und die Akzeptanz der herrschenden Ordnung aus Bestechung zu erklären. Creydt resümiert seine Kritik wie folgt: „Krysmanskis Duktus erinnert an einen Jahrmarktschreier, der sich an aufmerksamkeitsheischende Superlative gewöhnt hat. Unter „Gottesgnadentum“ oder dem „Milieu absoluter Korruption“ (Krysmanski 2004, 17) macht er es nicht. Krysmanski verbreitet Vorstellungen von Gesellschaft, in denen gesellschaftliche Strukturen und ökonomische Gesetze (z.B. zur Erklärung von Wirtschaftskrisen) keine Rolle spielen. (…) Der zugrunde liegende Vorstellungshorizont entspricht einer mittelgroßen Gemeinschaft, in der einige „Alphatiere“ sich eine Gefolgschaft gefügig machen und zusammen mit ihr den Rest manipulieren.“
- Details
- Geschrieben von: Björn Oellers
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 9861
Bernd Oellers veröffentlichte 2017 im Kritiknetz den Artikel "Konformität und Unterwerfung. Zum autoritären Charakter in der Lehre Hayeks" (https://bit.ly/2Ep9MaE). Im folgenden Text "Neoliberalismus versus Keynesianismus" greift er dieses Thema noch einmal auf und legt in komprimierter Form am Beispiel der Ökonomen G. Myrdal und Fr. A. von Hayek den Unterschied zwischen der keynesianischen politischen Ökonomie und der neoliberalen dar.
Heinz Gess
- Details
- Geschrieben von: Meinhard Creydt
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10176
M. Creydt kritisiert im folgenden Aufsatz die Parole vom wieder zu erlangenden "Primat der Politik". Er erblickt darin eine propagandistische Leerformel, die falsche Hoffnungen weckt und ein falsches Bewusstsein von den Problemen erzeugt, die zu lösen wären, wenn der Übergang in eine nachkapitalistische Gesellschaft, in der die Produzenten ihre Verhältnisse miteinander selbst bestimmen, gelingen soll. Die Prediger des "Primats der Politik" verleugnen diese Probleme. Sie gehen darüber hinweg, als gäbe es sie nicht und machen ihrer Gefolgschaft ein X für ein U vor. "Sie verlassen stillschweigend das Terrain, auf dem diese Probleme situiert sind. Sie verschieben, „versetzen” (MEW 18, 237) oder „transponieren” die Probleme in die politische „Ebene”, und ihnen entgeht die damit verbundene Verfremdung der Probleme.
- Details
- Geschrieben von: Meinhard Creydt
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 14555
Zur Kritik an gängigen Missverständnissen am Beispiel von Alex Demirovic
Das Verhältnis von Struktur und Handlung im Kapitalismus bildet ein schwieriges und bislang in der Diskussion häufig unbewältigtes Problem. In Abschnitt 2 und 3 des Textes stellt M. Creydt „konstruktive“ Überlegungen vor, in Abschnitt 4-6 kritisiert er die Auffassungen von Alex Demirovic zum Thema und vergegenwärtigt deren pseudopolitische Konsequenzen.
- Details
- Geschrieben von: Helmut Dahmer
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11565
aus der Reihe: Vor hundert Jahren
„Die Rechnung von Lenin und Genossen […] war diktiert von zwei rein revolutionären Gesichtspunkten: von dem unerschütterlichen Glauben an die europäische Revolution des Proletariats als den einzigen Ausweg und die unvermeidliche Konsequenz des Weltkrieges und von der ebenso unerschütterlichen Entschlossenheit, die einmal errungene Macht in Russland bis zum äußersten zu verteidigen, um sie zur energischsten und radikalsten Umwälzung auszunützen.“ (Rosa Luxemburg, September 1918)
Wie diese, unsere Vorläufer, rechnen wir damit, dass die Weiterentwicklung der kapitalistischen Weltwirtschaft auch im 21. Jahrhundert zu einer Serie von Katastrophen führen wird, weil es in ihrem Rahmen weder möglich ist, den Reichtum der Nationen umzuverteilen, noch das ökologische Desaster zu stoppen, noch die verheerenden Kriege zu beenden, von denen jederzeit einer zum allerletzten werden kann.
- Details
- Geschrieben von: Hannes Giessler Furlan
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12497
Die ursprüngliche sozialistische Akkumulation
aus der Reihe: vor hundert Jahren
Vor hundert Jahren fand die Oktoberrevolution statt. Der Kommunismus, auf den diese zielte, kam nicht zustande. Er könne erst gedeihen, wenn zuvor eine »ursprüngliche sozialistische Akkumulation« stattgefunden habe, behaupteten linksbolschewistische Theoretiker Mitte der 20er Jahre. Wenig später ließ Stalin die Linksbolschewisten verfolgen und deren Theorie auf seine Art in die Tat umsetzen. Zulasten der Landwirtschaft wurde die Industrie des Landes entwickelt. Die vielen Millionen Privat- und Subsistenzbauern wurden enteignet, ihre Produktions- und Subsistenzmittel vergesellschaftet (realiter verstaatlicht) und ihre Arbeitskraft der Planwirtschaft gefügig gemacht.
- Details
- Geschrieben von: Vivek Chibber
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11838
Auswege aus der Sackgasse postkolonialer Theorie
"Trotz der vielen Unstimmigkeiten, die im vergangenen Jahrhundert unter Radikalen und Progressiven herrschten, waren sie sich doch über zwei grundlegende Postulate fast immer einig – dass der Kapitalismus, während er sich ausbreitet, jede Region der Welt den gleichen Zwängen unterwirft; und dass, wohin er sich auch ausbreitet, die von ihm Unterjochten und Ausgebeuteten das gleiche Interesse haben, gegen ihn zu kämpfen, ungeachtet ihrer Kultur oder ihres Glaubens." (Chibber) Von dieser Prämisse nimmt die postkoloniale Theorie Abstand. Der Universalismus missachte das Lokale und Besondere und zwänge es "in rigide, von der europäischen Erfahrung abgeleitete Kategorien, die die Praxis lokaler Akteure nicht anerkennen und ihre tatsächliche Handlungsmacht missachten." (Chibber)
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12873
Eine Kritik des staatsfetischistischen Konzeptes der „Menschenrechte“
Hans-Peter Büttner befasst sich in seinem Essay mit dem Konzept der "Menschenrechte" soweit sie verbindlich kodifiziert und formuliert wurden durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Jahre 1948 und die Europäische Menschenrechtskonvention.
Er reflektiert kritisch die idealistische Überhöhung und unkritische Dauereuphorie und arbeitet dies kritisch-theoretisch auf.
- Details
- Geschrieben von: Bernd Ternes
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 9922
Das Wert(e)geheimnis und der Geheimniswert in modernen Gesellschaften
Im Zuge der sogenannten reflexiven Moderne ist dem Paar Geheimnis/ Transparenz das nämliche Schicksal zuteil geworden, wie es Jahrtausende früher schon dem Paar Wissen/ Nichtwissen widerfuhr. Sokrates’ resp. Platons Einsicht, um so mehr nicht zu wissen, je mehr man weiß, fand nun für das Geheimnis die Entsprechung: Je mehr die aufgeklärte Moderne qua Information, Kommunikation und Transparenzmedien Geheimnisse aufzulösen glaubte, desto mehr erzeugte sie diese im selben Maße. Die Teilung moderner Gesellschaften in eine offiziöse und in eine inoffiziöse wurde damit vor allem in der Postmoderne zum status quo.
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10553
Die politischen Auseinandersetzungen um die Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) und mit den USA (TTIP) laufen zurzeit auf Hochtouren und Massendemonstrationen gegen beide Abkommen finden statt. Deshalb ist es an der Zeit, sich erneut mit den Argumenten der Verfechter des globalen volkswirtschaftlichen Freihandels und ihren Hintergrundtheorien kritisch auseinanderzusetzen. Dazu gehören u.a. der englische Nationalökonom David Ricardo (1772-1823), der liberale Ökonom der Österreichischen Schule der Nationalökonomie Ludwig von Mises (1881-1973) und der US-Ökonom Paul A. Samuelson (1915-2009).
- Details
- Geschrieben von: Paul Stegemann
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10585
Zur Kritik eines Grundbegriffs bei Thomas Piketty
"Piketty bewegt sich auf den verdinglichten Hintergrund der modernen Wirtschaftswissenschaften; trotz aller Kritik, die er von dieser Seite einstecken muss. Andererseits wäre ihm nicht das große mediale und öffentliche Lob zuteil geworden, wenn er eine substantielle Kritik der kapitalistischen Gesellschaft formuliert hätte. Allen Kritikern der Ungleichheit sollte bewusst sein, dass eine grundsätzliche Kritik nur möglich ist, wenn man den kategorialen Rahmen der bürgerlichen Ökonomie kritisch überschreitet. Nur wer die Grundbegriffe des Kapitalismus kritisieren kann, wird perspektivisch eine fundamentale Gesellschaftsveränderung anvisieren können. Wer sich weiterhin im kategorialen Rahmen der bürgerlichen Ökonomie bewegt, wird diese weder theoretisch noch praktisch zu transzendieren vermögen. Das theoretische Überschreiten dieser Schranken des bürgerlichen Bewusstseins stellt sich als Prozess der Reflexion auf die unreflektierten Begriffe dar. Der Reformismus lässt sich also nicht nur an den befürworteten Maßnahmen ablesen (627ff.), sondern steckt konzeptuell in der Methode.
- Details
- Geschrieben von: Bernd Ternes
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10363
Vilém Flusser: „Ich lebe so oft, wie ich durch Vernetzung an Verknotungen teilnehme“
Es ist ruhig geworden um Medientheorie. Aus der Bundesrepublik, einstmals „Epizentrum der Medien- und Kommunikationstheorie“ (Hans Ulrich Gumprecht), ist nach dem diskursiven Versiegen postmoderner Theoriebildung kaum noch etwas zur Zukunft und zum Wirken der Medien mit jenem Eifer zu hören, wie er in den 1980er und 1990er Jahren – ausgehend von Frankreich – usus war. Eine der zentralen Topoi postmoderner Theorie war die Überzeugung, dass das Bewusstsein seinen Systemverbund aus biologischem Hirn, nervöser Elektrik und körperlicher Eingebundenheit verlässt („Exteriorität des Geistes“), um sich (in) anderen Systemverbänden ‚auszustellen’/ (auszusetzen) – apparative hardware und „symbolische“ software –; und dass es sich bei dieser Auswanderung nicht einfach nur um Auslagerung, um Erweiterung des Bewusstseins handelt, sondern um einen neuen Systembereich – mit einer impliziten, exklusiv eigenen, unreduzierbaren „Logik“ der Technisierung.
- Der prozessierende Widerspruch
- Vulgar Economics 2014
- Die Kategorie des „Nutzens“ in der neoklassischen Wirtschaftslehre
- Die Freundschaft zwischen Marx und Engels
- Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung (2012). Das ungeschönte Original zum Download
- Parlamentarismuskritik
- Echtzeit des Kapitals. Über die Zukunft der Krise
- Wertkritik als Gesellschaftskritik
- Rote Armee Fiktion
- Marx, Sraffa and the foundations of the Critique of Political Economy
- Charaktermasken abschminken
- Thesen zu Staat und Hegemonie in der Linie Gramsci Poulantzas
- Kritik der herrschenden ökonomischen Theorie
- Über die Zurichtung von Arbeitskraft im Zeitalter des Neoliberalismus
- Der autoritäre Staat
- Weltwirtschaftskrise und die falschen Propheten
- Reichtum und Nutzen
- Antisemitismus und Finanzkapital - Zur Kritik des völkischen Denkens des ehemaligen Linken - Jürgen Elsässer
- Kredit, Kapital und Krise - Von der Überakkumulation des Kapitals zur aktuellen Krise des Geldes
- Kapitalismus in der Krise - Die Finanzkrise: Ursachen und Folgen
- Turbokapitalismus. Analyse eines Ressentiments
- Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt
- Qualität und Quantität des Werts
- Statistisches Bundesamt: Wachstum 2007
- Wachstum 2007 - Daten des Statistischen Bundesamtes
- Semantik, Struktur, Handlung. Zum Problem der Geltung im Marxschen Kapital
- Daten zum Skandal der wachsenden sozialen Ungleichheit in Deutschland -
- Die bürgerliche Wissenschaft vom Reichtum als politische Ökomie des Reformismus
- Das Ende der Kritik der politischen Ökonomie
- Was ist die Werttheorie noch wert
- Kritik der politischen Ökomomie - Eine Einführung
- Monetäre Werttheorie. Geld und die Krise bei Marx
- Das Ende der politischen Ökonomie
- Formanalyse als Handlungstheorie?
- Das "Gesetz" vom tendenziellen Fall der Profitrate - Teil 2: Anmerkungen zum Papier "Profitratenfalle"von Henning Wasmus
- Das "Gesetz" vom tendenziellen Fall der Profitrate - Teil 1 Die "Profitratenfalle"
- Die Marxsche Werttheorie. Darstellung und gegenwärtige Bedeutung
- Globalisierter Konkurrenzkapitalismus
- Thesen zum Fetischcharakter der Ware und zum Austauschprozess
- Entfesselter Kapitalismus; Zur Kritik der Globalisierungskritik
- Geschichtsphilosophie bei Marx
- Diagnostik der Überflüssigen
- Weltanschauungsmarxismus oder Kritik der politischen Ökomomie