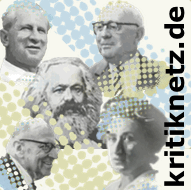Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
Beiträge der kritischen Theorie zur Kritik der Polischen Ökonomie und des Staates
- Details
- Geschrieben von: Jochen Böhmer
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11497
- Details
- Geschrieben von: Initiative Sozialistisches Forum
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11620
"Was aber ist der Run auf eine Bank gegen die Zerstörung des Bankwesens nur überhaupt? Was gegen die Aufhebung des Geldes? Die Abschaffung des Souveräns? Was ist die Kritik an der FAZ gegen die sofortige, unwiderrufliche Kündigung jeglichen Abonnements auf Ideologie? Was ist jetzt Aufklärung? Die Schlauesten der Propagandisten sagen: "All das Geld ist genau so lange sicher, bis es jemand haben möchte. Aber warum sollte es jemand haben wollen, wo es doch so sicher ist? Das Geld der Deutschen ist derzeit in einem logischen Rätsel angelegt." Und wenn dann der Dümmste der Kommunisten antworten würde: Das geht mich nichts an, denn es handelt sich nicht um ein "logisches Rätsel", das im Theoretischen zu lösen wäre, sondern um die gesellschaftliche Liquidation des Kapitals als der "Selbstverrätselung der Menschheit" (Marx), dann, ja: dann könnte die vermaledeite Geschichte gut ausgehen.
- Details
- Geschrieben von: Dieter Wolf
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11301
Makroökonomischer Ausblick auf den Zusammenhang von Warenzirkulation und Produktion
Heinz Gess
- Details
- Geschrieben von: Heinz Gess
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12888
Nach Angaben des Statistischen Budesamtes ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2007 preisbereinigt um 2,5% gewachsen. Die Konsumausgaben trugen mit 0,2% Punkten zum BIP-Wachstum bei.
Die auf den ersten Blick so positv aussehenden Daten zeigen bei etwas sorgsamerer, Betrachtung ihre andere Seite. Es stiegen nämlich auch die Kapitalerträge und sonstigen Vermögenserträge. Die Umverteilung von unten nach oben hält an - und zwar "nachhaltig". Darin drückt sich aus, dass die "organische Zusammensetzung des Kapitals" (Marx) steigt und der Wert der Arbeitskraft gesamtgesellschaftlich sinkt. Immer mehr müssen sich die vereinzelten Einzelnen, die nichts haben als sich selbst, nach der Decke strecken, um noch etwas von dem durch ihre Arbeit erwirtschaftetes Reichtum abzubekommen.
- Details
- Geschrieben von: Heinz Gess
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10120
Nach Angaben des Statistischen Budesamtes ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2007 preisbereinigt um 2,5% gewachsen. Um soviel höher war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach ersten Berechnungen des Amtes höher als im Vorjahr. Die Konsumausgaben trugen mit 0,2% Punkten zum BIP Wachstum bei.
In den so positiv erscheinenden Daten drückt sich bei etwas genauerer Betrachtung aus, dass die "organische Zusammensetzung des Kapitals" (Marx, MEW 23) steigt und der Wert der Arbeitskraft gesamtgesellschaftlich sinkt. Immer mehr müssen sich die vereinzelten Einzelnen, die nichts haben als sich selbst, nach der Decke strecken, um noch etwas von dem durch ihre Arbeit erwirtschafteten Reichtum abzubekommen.
- Details
- Geschrieben von: Dieter Wolf
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11696
- Details
- Geschrieben von: DIW
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 13453
Das Vermögen ist in Deutschland wesentlich ungleicher verteilt als Einkommen. Nach der jüngsten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (88672. Wochenbericht des DIW Berlin Nr.45/2007 ) verfügen rund zwei Drittel der Bevölkerung ab 17 Jahren über kein oder nur ein sehr geringes Vermögen. Im Durchschnitt betrug das individuelle Netto-Vermögen im Jahr 2002 rund 81 000 Euro. Aufgrund der sehr ungleichen Verteilung liegt der Median, also der Wert, der die reiche Hälfte der Bevölkerung von der ärmeren trennt, nur bei etwa 15 000 Euro. Im Gegensatz dazu besitzen die reichsten 10 Prozent knapp 60 Prozent des gesamten Vermögens. Das arithmetische Mittel beläuft sich in Deutschland insgesamt auf knapp 81 000 Euro, wobei Personen in den alten Ländern mit knapp unter 92 000 Euro rund 2,6-mal soviel Vermögen besitzen wie diejenigen in den neuen Ländern.
- Details
- Geschrieben von: Joachim Bruhn
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10970
Das Bewußtsein dieser falschen Versöhnung auf dem Boden einer falschen Spaltung heißt John Maynard Keynes; in ihm kommt der Gesamtprozess zu Bewußtsein. Vor Keynes waren Begriff und Sache der Krise Anathema gewesen; mit Keynes wird die Krise zum Grundproblem der Ökonomie überhaupt und wird der Staat zum Generalbevollmächtigten, in Permanenz tagenden großen Krisenausschuss. Der Staat wird das formelle Subjekt einer Ökonomie, dessen materieller Autor das Kapitalverhältnis darstellt; "Basis" und "Überbau" treten in ein Verhältnis wechselseitiger Konstitution.
Der Keynesianismus ist die unhintergehbare Ideologie des Staates als ökonomischer Agent wie als Generalbevollmächtigter des Kapitalverhältnisses. Darin spiegeln sich das objektive Interesse wie der subjektive Konsens der zu Funktionsträgern mutierten Klassen am objektiven Zwangscharakter der Akkumulation.
- Details
- Geschrieben von: Joachim Bruhn
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 9668
In der Konsequenz der Frage Pollocks hatte Horkheimer vom "Ende der politischen Ökonomie" geschrieben, von der negativen Aufhebung des Kapitals im Verfolg der Logik des Kapitals selbst, vermittelt durch Krise und Zusammenbruch: "Die Kategorien der politischen Ökonomie: Äquivalententausch, Konzentration, Zentralisation, sinkende Profitrate usf. haben auch heute noch reale Gültigkeit, nur ist ihre Konsequenz, das Ende der politischen Ökonomie, erreicht", heißt es 1939 in "Die Juden und Europa".[12] Er hat damit, obwohl in der Sprache der Tradition, die absolute historische wie logische Grenze des Marxismus, sein Tabu und sein tiefstes Schweigen, gebrochen, d.h. den Moment bestimmt, in dem Marxismus in Materialismus überzugehen verpflichtet ist.
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12447
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 14350
Vorwort
1. Kapitalismus und "Marxismus"
1.1 Was ist Kapitalismus?
1.2 Die Entstehung der Arbeiterbewegung
1.3 Marx und der "Marxismus"
2. Der Gegenstand des Marxschen Kapital
2.1 Theorie und Geschichte
2.2 Theorie und Kritik
2.3 Dialektik - eine marxistische Wunderwaffe?
3. Wert, Arbeit, Geld
3.1 Gebrauchswert, Tauschwert und Wert
3.2 Ein Beweis der Arbeitswertlehre? (Individuelles Handeln und gesellschaftliche Struktur)
3.3 Abstrakte Arbeit: Realabstraktion und Geltungsverhältnis
3.4 "Gespenstische" Wertgegenständlichkeit - Produktions- oder Zirkulationstheorie des Werts?
3.5 Wertform und Geldform (Ökonomische Formbestimmungen)
3.6 Geld und Austauschprozess (Handlungen der Warenbesitzer)
3.7 Geldfunktionen, Geldware und das moderne Geldsystem
3.
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12856
- Details
- Geschrieben von: Joachim Bruhn
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10499
In der Konsequenz der Frage Pollocks hatte Horkheimer vom "Ende der politischen Ökonomie" geschrieben, von der negativen Aufhebung des Kapitals im Verfolg der Logik des Kapitals selbst, vermittelt durch Krise und Zusammenbruch: "Die Kategorien der politischen Ökonomie: Äquivalententausch, Konzentration, Zentralisation, sinkende Profitrate usf. haben auch heute noch reale Gültigkeit, nur ist ihre Konsequenz, das Ende der politischen Ökonomie, erreicht", heißt es 1939 in "Die Juden und Europa".[12] Er hat damit, obwohl in der Sprache der Tradition, die absolute historische wie logische Grenze des Marxismus, sein Tabu und sein tiefstes Schweigen, gebrochen, d.h. den Moment bestimmt, in dem Marxismus in Materialismus überzugehen verpflichtet ist.
- Details
- Geschrieben von: Ingo Elbe
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11278
Die Antikritik der Entgegnung Martin Eichlers zu Ingo Elbes Beiträgen "Helmut Reichelts Geltungstheorie" sowie "Methodische Abstraktion und objektive Semantik".
Es geht um die Frage, wie plausibel handlungstheoretische Konzeptualisierungen ökonomischer Gegenständlichkeit sind.
"Die ausführlichen Kritiken von Dieter Wolf an Helmut Reichelt, die in den Beiträgen von Eichler und Elbe behandelt werden, sind nun auch auf der Homepage von Dieter Wolf online zugänglich: http://www.dieterwolf.net/pdf/Heft3.pdf sowie http://www.dieterwolf.net/pdf/Replik,Knaudt,Var2,0GGG.pdf"
Heinz Gess
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12803
- Details
- Geschrieben von: Henning Wasmus
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12553
Die Begründung des tendenziellen Fallls der Profitrate und von Momenten, die ihm zu widersprechen scheinen
- Details
- Geschrieben von: Nils Fröhlich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 15710
2 Grundbegriffe der Marx'schen Werttheorie 9
2.1 Die Darstellung im "Kapital" 9
2.1.1 Die Waren als Wertträger 10
2.1.2 Rekonstruktion: Prämissen der Werttheorie 14
2.2 Die Bedeutung der abstrakten Arbeit 18
2.3 Die Wertgegenständlichkeit 29
2.3.1 Wert als gesellschaftliches Verhältnis 29
2.3.2 Die Wertgröße der Waren 32
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12317
- Details
- Geschrieben von: Ingo Elbe
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 21586
- Details
- Geschrieben von: Michael Heinrich
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 5258