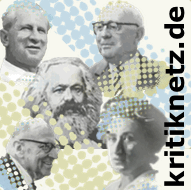Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
Beiträge der kritischen Theorie zur Kritik der Polischen Ökonomie und des Staates
- Details
- Geschrieben von: Claus Peter Ortlieb
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12291
Produktion des relativen Mehrwerts und Krisendynamik
Marx schreibt in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie
„Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren sucht, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt.“ (Marx 1974: 593)
„Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen … erscheinen dem Kapital nur als Mittel, um von seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. In fact aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen.“ (Marx 1974: 593/594).
Nach Marx steuert das Kapital historisch auf eine fundamentale krise zu, weil wegen der wachsenden Produktivität die gesamtgesellschaftliche bzw. globale Mehrwertproduktion auf Dauer abnehmen und die Kapitalverwertung schließlich zum Erliegen kommen müsse. Ortlieb überprüft diesen Gedanken mit Erkenntnissen und Erkenntnismitteln von heute, wozu auch ein wenig Mathematik gehört.
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 9773
Zu Stefan Franks Kritik der Marx'schen Kritik der Politischen Ökonomie
Hans Peter Büttner setzt sich in folgendem Essay kritisch mit Stefan Franks postmoderner Revision der „Kritik der politischen Ökonomie ( „Von Bibern und Hirschen“, in Konkret 10/2014) auseinander. Er schreibt: "Franks Ausführungen stellen den Versuch einer Kritik der Marx’schen Werttheorie, der Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate und anderer Bestandteile des Marx’schen Forschungsprogramms dar; jedoch scheitert der Versuch bereits im Ansatz, da der Autor nachweislich nicht in der Lage oder Willens ist, elementare theoretische Aussagen der Kritik der Politischen Ökonomie adäquat zu erfassen.“
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 10268
Eine Kritik der Grundlagen der subjektiven WerttheorieDer britische Ökonom Nicholas Kaldor (1908-1986) stellte 1972 fest, dass „die Entwicklung der ökonomischen Theorie die eines ständigen Rückschritts, nicht Fortschritts“[1] gewesen sei. Diese für die Ökonomie desaströse Entwicklung führte er auf die sich gegen die Erfahrung verselbständigende, immer realitätsfernere, mathematische Ausarbeitung der frühen neoklassischen Konzeption zum ökonomischen Gleichgewicht zurück. Hans Peter Büttners Untersuchung bestätigt diese Einschätzung und benennt Mängel der Theorie, die in ihrem Rahmen ganz offensichtlich nicht behebbar sind, wenngleich das auch von den Professionals der „Volkswirtschaftlehre“ mit immer neuen Ad-hoc-Annahmen versucht wird. Denn der grundlegende Mangel der ökonomischen Theorie liegt in der Denkform selbst, in der die ökonomische Theorie sich bewusstlos bewegt, statt kritisch auf sie zu reflektieren. Sie ist das tief verinnerlichte subjektive Pendant der gesellschaftlichen Synthesis am kapitalistischen Geld; jene auf spezifische Weise abstrakte Denkform, die der gesellschaftlichen Synthesis am kapitalistischen Geld entspricht, aus ihr im 16. Jahrhundert entsprungen ist und seit dem 17. Jahrhundert von Europa aus ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat. Die ökonomische Theorie, wie sie derzeit betrieben wird, ist nur die bewusstlos-reflexive Verdoppelung dieser aus der gesellschaftlichen Synthesis am Geld entsprungenen, Denkform und damit zugleich ihre Selbstaffirmation als „Wissenschaft“. Deshalb ist es auch zutreffend, sie als „bürgerliche“ oder „kapitalistische Ökonomie“ im Doppelsinn des Wortes zu bezeichnen. Als solche ist sie Ideologie im genauen Sinn des Marx’schen Wortes: „notwendig falsches Bewusstsein“.
- Details
- Geschrieben von: Bernd Ternes
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 16359
Impressionen aus der Innenwelt einer fast 40jährigen Freundschaft von Marx und Engels anhand des Briefwechsels 1844-1883
Auf den folgenden 126 Seiten lesen Sie vor allem von Bernd Ternes ausgewählte und zusammengestellte Auszüge aus den Briefen von Karl Marx an Friedrich Engels und - etwas weniger – von Engels an Marx, während der Autor selber sich mit seinen Interpretationen zurückhält. Seine Zurückhaltung begründet er wie folgt: „Die Anteilnahme an den Briefmitteilungen blieb auch noch zu einem späten Zeitpunkt der Textdurcharbeitung derart immens, daß kein Jota an Singularität, Opakheit, Selbstevidenz der vorliegenden Textur verlustig gehen wollte – dieses Verlustiggehen ist elementare Voraussetzung für den Vergleich, für Referenzbildung, für Kategorisierung und für Abstraktion. Doch die Leseerfahrung suchte sich immer wieder die sensitive Fühlungnahme und stellt die Konzeption hintan.
- Details
- Geschrieben von: Bundesregierung
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11812
Zum Inhalt:
Die Schere zwischen arm und reich in Deutschland driftet immer weiter auseinander. War schon der Zweite Armutsbericht ( s. Kritiknetz -http://bit.ly/Oe3cFE) in dieser Hinsicht alarmierend, so hat sich die Situation seitdem auch infolge der Untätigkeit der schwarz/gelben Regierung, die negativen Resultate früherer politischer Eingriffe zur Umverteilung des Vermögens von unten nach oben durch koorigierende Eingriffe zu mindern, dratisch verschlechtert.
So hat sich das private Nettovermögen von Anfang 1992 bis Anfang 2012 von knapp 4,6 Billionen auf rund zehn Billionen Euro mehr als verdoppelt. Allein in der "Krisenperiode" zwischen 2007 und 2012 sei das private Nettovermögen - dazu zählen etwa Immobilien, Bauland, Geldanlagen oder Ansprüche aus Betriebsrenten - um 1,4 Billionen Euro gewachsen.
Dabei ist der Anteil des obersten Zehntels der privaten Haushalte nach Angaben des Arbeitsministeriuns "im Zeitverlauf immer weiter gestiegen". 1998 belief er sich auf 45 Prozent des gesamten Vermögens. 2008 befand sich in den Händen dieser Gruppe der reichsten Haushalte bereits mehr als 53 Prozent des Nettogesamtvermögens. Die untere Hälfte der Haushalte verfügt über nur gut ein Prozent des gesamten Nettovermögens.
Enorme Differenzen verzeichnet der Bericht auch bei der Lohnentwicklung: Sie ist "im oberen Bereich positiv steigend" gewesen, während die unteren 40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten nach Abzug der Inflationsrate reale Einkommensverluste hinnehmen mussten.
Fortgesetzt hat sich auch der Trend des Abschmelzens des Vermögens des Staates. Es sei zwischen Anfang 1992 und Anfang 2012 um mehr als 800 Milliarden Euro zurückgegangen, während die Privatvermögen der reichsten 10% - mit einer höheren Wachstumsrate als jener mit der das öffentlche Vermögen abgebaut wurde - im selben Zeitraum kontinuierlich anstieg.
- Details
- Geschrieben von: Wilma Ruth Albrecht
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 13823
"ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können“ (Brecht).
Vorbemerkung der Autorin
Zugegeben: Als ich in der letzten Woche im "Amtsblatt" meiner Heimatstadt im NRW-Südzipfel zur "Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27.09.2009" las: "Wahlrecht ist Wahlpflicht", "Stimmenthaltung schwächt die Legitimation der Regierung" und "Nichtwähler unterstützen den Wahlgewinner" - da war ich weder verwundert noch verärgert. Denn ich kenne auch diese Politpappenheimer seit Jahrzehnten und weiß, welche Losungen hier plappermäulig fröhlich´ Urständ' feiern und daß nach dem Morgensternmotto ("Dass nicht sein kann was nicht sein darf") die subjektrationale Handlung des Nichtwählens auf Teufel komm´ raus denunziert und aus allen Rohren beschossen werden muß.
Zornig wurde ich bei der Lektüre der von der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) herausgegebenen Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament" (38/09), in der sich unterm Leitwort Parlamentarismus nicht nur politologische Nebensächlich - keiten zum 27. September 2009 finden, sondern in der Orientierung aufs Letztdatum des ganzdeutschen "Superwahljahrs" 2009 grad in zwei kritisch gemeinten politologischen Beiträgen jede kritische Orientierung fehlt - als ginge es Karl-Rudolf Korte vordringlich um handlungsbezogene Paradoxata wie Umrechnung, Abwahl, Ungleichzeitigkeit, Lindenstraße, Abschwung und Ampel nebst interessensfalsifiziert- "postmodernen" Regierungsbildungsprozessen und Kurt Lenk um den "Drang" zur Politmitte als "Abschied von der Utopie" - grad so als wäre jede konzeptionell geleitete analytische Interessensstrukturanalyse im öffentlichen Diskurs tabuiert.
- Details
- Geschrieben von: Joachim Bruhn
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11433
Eine fulminante Abhandlung über die Zukunft der derzeitigen Krise.
- Details
- Geschrieben von: Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11377
Zum Tod des wertkritischen Ökonomen Robert Kurz
Wer die Debatte zur aktuellen Weltwirtschaftskrise verfolgt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die kapitalistische Produktionsweise allein an Verteilungsproblemen und mangelnder Banken- bzw. Finanzmarktregulierung durch den Staat krankt. Einen gänzlich anderen Blick auf das kapitalistische Gesellschaftssystem vermittelte der am 18. Juli verstorbene marxistische Ökonom und Gesellschaftskritiker Robert Kurz. Sein widerständiges Denken kreiste beständig – und seit Beginn der neunziger Jahre mit einem bemerkenswerten Widerhall innerhalb der bundesdeutschen Linken – um die wert- und krisentheoretische Deutung der Marxschen Kritik der Politischen Ökonomie. Dabei verweigerte sich Robert Kurz der seit Ende der siebziger Jahren verfestigten Resignation marxistischer Ökonomiekritiker und formulierte seine Kritik sowohl des neoklassisch-wirtschaftsliberalen wie auch der keynesianisch-staatsregulativen Denkansatzes innerhalb des wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams.
Ebenso verweigerte sich Robert Kurz der falschen Alternative zwischen liberaler Staatskritik einerseits und dem Ruf nach dem autoritären Staat. Für ihn war keine der beiden Seiten der Alternative emanzipatorisch besetzbar. Vielmehr reflektiert sie als ganze immer nur die gesellschaftlichen Widersprüche des modernen kapitalistischen Systems: Entweder muss sich die menschliche ‚Souveränität’ gegenüber der Marktmaschine als autoritäre Kontrolle des Staates über die Individuen maskieren, oder die ‚Freiheit’ der Individuen muss sich als totale Selbstauslieferung des menschlichen Willens an den blinden Lauf der Marktmaschine maskieren". Diese falsche Alternative zwischen den rein äußerlich aufeinander bezogenen Sphären von bürgerlichem Staat und kapitalistischem Markt destruierte Robert Kurz in vielen seiner Texte gründlich.
Sein Denken, für das Gesellschaftskritik essentiell Wertkritik war, beruhte wie das Horkheimers auf einem Existentialurteil über die Zurichtung des Menschen für die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals. Ihre Kritik fortzuführen ist eine dornenreiche, aber notwendige Aufgabe für all jene, die das Existenzialurteil teilen.
Für die emanzipatorische Linke geht mit Robert Kurz ein kompromissloser Denker verloren, dessen vom Zorn auf das schlechte Bestehende inspirierte Kritik motivierend und inspirierend bleibt.
- Details
- Geschrieben von: Initiative Sozialistisches Forum
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 13012
- Details
- Geschrieben von: Andrew Klimann, Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12092
An Interview with Andrew Kliman by Hans Peter Büttner
Mit einer Einführung in die Thematik: Was ist die „Temporal Single System Interpretation“ (TSSI-) des Marxschen „Kapital“? (in deutscher Sprache)
Vorwort:
Im folgenden Betrag veröffentlicht das Kritiknetz ein Interview, das Hans Peter Büttner (Konstanz) mit Andrew Kliman, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Pace University in New York und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Fragen der marxistischen Wirtschaftstheorie geführt hat. Kliman hat bei Marx unbearbeitete Probleme der Wert-Preis-Rechnung, die das Problem der Transformation von Werten in Marktpreise (s. Bd. 3 des „Kapitals) lösen sollte, sich aber nach der vorherr-schenden Auffassung in der Wirtschaftswissenschaft dazu als unzureichend erwies, auf der Grundlage einer Methodik (TSSI-Methode), die die Bewegung des Kapitals als eine sukzessiv-zeitförmige, rekursive Bewegung begreift und damit eben genau so wie Marx selbst, neu wieder aufgreift und auf dieser Grundlage sämtliche Aussagen der Marxschen Kritik ohne logische Inkonsistenzen rekonstruiert. In seiner 2011 erschienen Monographie „The Failure of Capitalist Production. Underlying Causes of the Great Recession” demonstriert er an der seit 2008 sich global ausbreitende Wirtschaftskrise, dass sich die Marxsche kritische Theorie insbesondere seine Behauptung vom tendenziellen Fall der Profitrate, berechnet nach der TSSI-Methode auch empirisch bewährt.
- Details
- Geschrieben von: Joachim Bruhn
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 11779
Die RAF wollte auf den Staat schießen, am Ende lag ein Mensch auf der Straße: am Grab der Banker und Vorstandsvorsitzenden stellte der Staat sich dar als bloßes Netzwerk, geknüpft aus nichts als Menschen wie Du und Ich, als Interaktionszusammenhang bedürftiger Körper und als Familie Eigentlich, so läßt sich die Frankfurter Allgemeine schreiben, "hat ein Staat keine Emotionen" , aber beim Leichenschmaus für seine Agenten ist's wirklich herzergreifend und zum Heulen. Es ist diese intellektuelle Subalternität, die aus der jüngsten Erklärung von Christian Klar spricht, und die man, ohne den Ex-Innenminister Baum zu loben, bestimmt als "Revolutionskauderwelsch" denunzieren darf. Anders war es niemals gewesen, und wenn die gefangenen Genossen in Stammheim einander anherrschten: "tauch mal unter, "in die tiefe', such und find die subtilen, terrorisierenden, blutsaugenden mechanismen des weltmarkts, gesamtkapitals in dir" , wäre eine strikt freudianische Psychoanalyse angebracht gewesen, nicht weiteres Training der Mao-Bibel. Bröckling.
Die Kritik der Waffen, die die RAF in Szene setzte, hatte die sozialphilosophische Qualität eines Brühwürfels.
Heinz Gess
- Details
- Geschrieben von: Ingo Elbe
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 15459
- Details
- Geschrieben von: Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12012
Der folgende Aufsatz von HaPE Büttner, einem meiner besten und mir liebsten Studenten (aus den frühen neunziger Jahren), stellt in komprimierter Form die ökonomietheoretische Kritik der wirtschaftswissenschaftlichen Standardlehre neoklassischer Provenienz durch die an dem Cambridge-Ökonomen Piero Sraffa (1898-1983) orientierte neoricardianische Schule dar. Dabei orientiert sich der Autor an den drei historischen Debatten zur Kosten-, Kapital- und Wettbewerbstheorie sowie deren logischen Zusammenhängen. Die sich auf Sraffa beziehende ökonomische Denkschule wird als „neoricardianisch“ bezeichnet, weil Piero Sraffas Studien der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts in eine radikalen Kritik der herrschenden, neoklassischen Theorie einerseits und intensiven Bemühungen zu einer konsistenten, fruchtbaren Reformulierung des klassischen, auf David Ricardo (1772-1823) zurückgehenden ökonomischen Ansatzes andererseits, mündeten. Das Erscheinen von Sraffas Hauptwerk „Waren-produktion mittels Waren“ – des zentralen Referenzpunktes der Neoricardianer – im Jahre 1960 jährt sich in diesem Jahr zum fünfzigsten Mal. Es zeigt sich, dass die durch Sraffa angeregte – und von seinen Schülern vielfach weitergeführte – Kritik in überzeugender Art und Weise der bis heute dominierenden ökonomischen Lehre eine Reihe schwerwiegender logischer Fehler nachweisen konnte, die in ihrer Bedeutung ökonomiekritisch orientierten Menschen nur allzu oft nicht bekannt sind. Der folgende Text beabsichtigt deshalb, Interesse zu wecken an einer Verbreitung und Fortführungen der von Sraffa begonnenen Kritik.
- Details
- Geschrieben von: Michael Wolf
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 13248
Außer daß sie von der seinerzeitigen rot-grünen Bundesregierung unter dem »Basta-Kanzler« Gerhard Schröder ins Werk gesetzt wurde, hat die ›Bologna-Prozeß‹ genannte Hochschulreform mit der Hartz-IV-Arbeitsmarktreform nur wenig zu tun. – Allerdings nur auf den ersten Blick. Sieht man nämlich genauer hin, dann zeigt sich, daß beide Reformen nicht nur in ihrem Ziel übereinstimmen, sondern auch in ihren auf Kontrolle und Zwang setzenden Methoden. In dem auf einem Vortrag basierenden Essay wird mit Rekurs auf regulations- und gouvernementalitätstheoretische Grundvorstellungen Plausibilität für die These zu erzeugen versucht, daß die beiden staatlicherseits vorangetriebenen Reformen eine spezifische, auf die Herstellung von ›employability‹ zielende Form der Anpassung an den Prozeß der Globalisierung darstellen, mit der das gesamte soziale Leben so gesteuert und staatlich organisiert werden soll, daß jeder Arbeitskraftbesitzer seine Unterwerfung unter die Bedingungen kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Rationalität und die Erfordernisse politischer Machterhaltung selbst betreibt und sich mit seinen Potentialen möglichst freiwillig und reibungslos in den auf Ausbeutung beruhenden kapitalistischen Prozeß der Mehrwert- und Reichtumsproduktion einbringt. Hierbei erfolgt der Versuch des totalitären Zugriffs auf die menschliche Subjektivität dadurch, daß die Betroffenen einerseits über die Zuschreibung von Eigenverantwortung als autonome Subjekte angerufen werden, während man sie andererseits zugleich in spezifische Kontroll- und Sicherungsstrategien einbindet, damit die abverlangte ›Autonomie‹ nicht aus dem Ruder läuft
Michael Wolf
- Details
- Geschrieben von: Heinz Gess
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 13782
- Details
- Geschrieben von: Reinhard Crusius
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12781
Inzwischen hat ja eine zaghafte Diskussion unter den deutschen Ökonomen (und in der Wirtschaftspresse) angefangen, typischerweise sehr akademisch, formal und methodenfixiert – also eher eine Illustration meiner Kritik, die sich ja auf Inhalte bezieht! Es bleibt aber weiterhin dabei, dass weder in der Publizistik noch wissenschaftsintern das Versagen – und die Mittäterschaft (!) – der wissen-schaftlichen Ökonomie aufgerollt wird, obwohl sowohl die reale Entwicklung als auch wenige inzwischen vorliegende Forschungsbeiträge meine Fragen, meine Kritik und meine Forderungen immer heftiger bestätigen. Die Verengung auf Methodenfragen der Ökonomie statt auf inhaltliche Probleme wird zum Beispiel deutlich an dem m. E. "kuriosen" Faktum, dass in der Kritik ausschließ-lich die Volkswirtschaftslehre steht, als habe der ganze Kladderadatsch mit der axiomatisch total verkanteten Betriebswirtschaftslehre überhaupt nichts zu tun. Und die theoretischen Gurus dieses Kladderadatsches, z. B. Herr Straubhaar in Hamburg, schwadronieren schon wieder z. B. von der Abschaffung der Flächen-tarife – wider alle Erfahrungen, die gerade Deutschland in dieser Krise gemacht hat.
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 12162
Eine Kritik der Grundlagen der subjektiven Werttheorie
Die neoklassische ökonomische Theorie versteht sich als „subjektive Werttheorie“, welche im Gegensatz zur ökonomischen Klassik konsequent vom methodologischen Individualismus ausgeht. Gesellschaftliche Phänomene und Strukturzusammenhänge werden hier verstanden als Ergebnisse rationaler, nutzenmaximierender Wahlhandlungen der über den Tausch kommunizierenden Wirtschaftssubjekte. Entsprechend ihrer wohl geordneten Präferenzordnungen und ihrer Budgetmöglichkeiten bieten diese Individuen Güter und Dienste an und fragen Güter und Dienste nach. Im Gleichgewicht ist dieses System in dem Moment, in dem jedes Marktsubjekt seine Pläne – entsprechend seiner Restriktionen und des sich durch Angebot und Nachfrage aller Marktteilnehmer einstellenden Systems relativer Preise – vollständig verwirklichen kann. Um ihre Programmatik in eine in sich stimmige und konsistente Form zu bringen, muss die Neoklassik ein sehr weitreichendes Modell individueller Rationalität und der Konstitution sozialer Systeme durch die Handlungen entsprechend modellierter Marktsubjekte entwerfen.
- Details
- Geschrieben von: Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 14546
Hans Peter Büttner unterzieht dieses Konzept der "Überwindung des Gegensatzes von rechts und links" einer ausführlichen Kritik. Am Objekt der Elsässerschen Bemühungen gibt er eine Einschätzung der Hintergründe der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise im Lichte der Kritik der Politischen Ökonomie (Marx) und diskutiert mögliche Gegenwehr-Strategien.
- Details
- Geschrieben von: Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 21482
Die Krise
Wenn die Börsenkurse fallen
regt sich Kummer bei fast allen,
aber manche blühen auf:
Ihr Rezept heißt Leerverkauf.
Keck verhökern diese Knaben
Dinge, die sie gar nicht haben.
Treten selbst den Absturz los,
den sie brauchen - echt famos!
.......
Fortsetzung s. erweiterte Einführung
1. Kredite und "Subprimes"
2. Wie lief die Hypothekenkrise ab?
3. Die nächste Stufe der Finanzkrise
4. Staatsverschuldung und der Niedergang der Geldform
5. Neue Barbarei oder Ende des Kapitalfetischs
- Details
- Geschrieben von: Hans Peter Büttner
- Kategorie: Kritik der Politischen Ökonomie, Staatskritik
- Zugriffe: 14456
- Turbokapitalismus. Analyse eines Ressentiments
- Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt
- Qualität und Quantität des Werts
- Statistisches Bundesamt: Wachstum 2007
- Wachstum 2007 - Daten des Statistischen Bundesamtes
- Semantik, Struktur, Handlung. Zum Problem der Geltung im Marxschen Kapital
- Daten zum Skandal der wachsenden sozialen Ungleichheit in Deutschland -
- Die bürgerliche Wissenschaft vom Reichtum als politische Ökomie des Reformismus
- Das Ende der Kritik der politischen Ökonomie
- Was ist die Werttheorie noch wert
- Kritik der politischen Ökomomie - Eine Einführung
- Monetäre Werttheorie. Geld und die Krise bei Marx
- Das Ende der politischen Ökonomie
- Formanalyse als Handlungstheorie?
- Das "Gesetz" vom tendenziellen Fall der Profitrate - Teil 2: Anmerkungen zum Papier "Profitratenfalle"von Henning Wasmus
- Das "Gesetz" vom tendenziellen Fall der Profitrate - Teil 1 Die "Profitratenfalle"
- Die Marxsche Werttheorie. Darstellung und gegenwärtige Bedeutung
- Globalisierter Konkurrenzkapitalismus
- Thesen zum Fetischcharakter der Ware und zum Austauschprozess
- Entfesselter Kapitalismus; Zur Kritik der Globalisierungskritik
- Geschichtsphilosophie bei Marx
- Diagnostik der Überflüssigen
- Weltanschauungsmarxismus oder Kritik der politischen Ökomomie