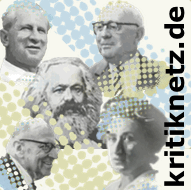Die politischen Auseinandersetzungen um die Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) und mit den USA (TTIP) laufen zurzeit auf Hochtouren und Massendemonstrationen gegen beide Abkommen finden statt. Deshalb ist es an der Zeit, sich erneut mit den Argumenten der Verfechter des globalen volkswirtschaftlichen Freihandels und ihren Hintergrundtheorien kritisch auseinanderzusetzen. Dazu gehören u.a. der englische Nationalökonom David Ricardo (1772-1823), der liberale Ökonom der Österreichischen Schule der Nationalökonomie Ludwig von Mises (1881-1973) und der US-Ökonom Paul A. Samuelson (1915-2009).
Für sie alle ist ausgemacht, dass ein freier Handel allen zu Gute kommt, denn bei einem freien Austausch der Waren könne sich jedes Land auf die Produkte spezialisieren, die es am besten und kostengünstigsten herstellen kann. Durch diese Spezialisierung werde der effizienteste Umgang mit den eigenen Ressourcen und dadurch wiederum eine optimale Position auf dem Weltmarkt, wo Ressourcenverschwendung durch Konzentration auf vergleichsweise weniger ertragreiche Produktionsprozesse sich in sinkender Außenkaufkraft ausdrücke, gewährleistet. Wirtschaftswissenschaftler kennen diese Theorie der Außenwirtschaft als Theorem des „komparativen Kostenvorteils“. Sie sagt aus, dass sich die internationale Arbeitsteilung über die arbeitsteilige Spezialisierung im Rahmen relativer Kostenvorteile bzw. -nachteile einzelner Produktionsstandorte herausbildet. Auch moderne Lehrbücher wie das Standardwerk „Soziologie“ (Band 3: Soziales Handeln) von Hartmut Esser vertreten diese Theorie.
Hans-Peter Büttner setzt sich mit ihr im folgenden Text kritisch auseinander und stellt dar, warum sie nicht stimmt.
Heinz Gess
Wenn Sie den Text lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .