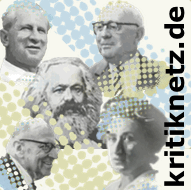Kritische Theorie als Paradigma
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 5577
Im Zentrum dieses Beitrags über das Konzept der Alternative im Umkreis der ‘Frankfurter Schule’ nach 1933 stehen entsprechende Gedanken von Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (Abschnitte 3 bis 5). Die Suche nach Alternativen konnte gerade im Jahr 1933 auch ganz anders ausgehen als bei den drei Genannten (Abschnitt 2). Horkheimer und Adorno sind Philosophen, für die das Suchen, Auffinden und Formulieren von alternativen Politikentwürfen zum Kern ihres Denkens gehört. Sie bleiben allerdings – zumindest nach 1939 – skeptisch gegenüber der Vorstellung, man könne gewünschte Alternativen mit Hilfe revolutionärer Rhetorik einer Verwirklichung näher bringen.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 8273
Oskar Negt, dieser bedeutende Soziologe und Philosoph aus der ‘zweiten Generation’ der ‘Frankfurter Schule’, ist am 1. August 2019 85 Jahre alt geworden. Im folgenden Beitrag geht es vor allem um seine Stellung zu Theodor W. Adorno, zu Jürgen Habermas und zu Alexander Kluge. Negt, sagt sein Freund Kluge, lebe „eine Haltung, die der inneren Struktur des politischen Protests und der Kritischen Theorie“ entspreche (Kluge 2001, S. 6). – Der Titel des Beitrags greift eine Formulierung von Ernst Bloch auf, der 1953 ein Bändchen Christian Thomasius, ein deutscher Gelehrter ohne Misere veröffentlicht hat.
- Details
- Geschrieben von: Hendrik Wallat
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 12821
Reflexion auf Voraussetzungen der Gesellschaftskritik
Der Text von Hendrik Wallat reflektiert Voraussetzungen der kritischen Theorie der Gesellschaft. Das geschieht in Form einer subtilen Analyse metaphysikkritischer Argumentationen. In ihrem Zentrum stehen Friedrich Nietzsches vernichtende Metaphysikkritik und Karl Heinz Haags „negative Metaphysik“.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 7225
Selbstzeugnisse und Anekdoten
Vor fünfzig Jahren, am 6. August 1969, ist Theodor W. Adorno überraschend in der Schweiz an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben. Der folgende Beitrag stellt zum Gedenken an Adorno Selbstzeugnisse und Anekdoten über ihn zusammen, um dadurch etwas zum Bild seiner Persönlichkeit beizutragen.
- Details
- Geschrieben von: Helmut Dahmer
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 8567
Im Frühjahr dieses Jahres (2019) erschien im Verlag “Westfälisches Dampfboot“ ein neues Buch von Helmut Dahmer mit dem Titel „Freud, Trotzki und der Horkheimer-Kreis. In seinem zweiten Teil stellt der Autor detailliert das Netzwerk der Revolutionstheoretiker und -praktiker dar, in dem sich die Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung bewegten. Damit füllt er eine bei vielen bis heute bestehende Wissenslücke. Denn es gehörte zur Überlebensstrategie des Instituts in der Emigration, diese Kontakte und inhaltlichen Bezüge in den veröffentlichten Schriften des Instituts zu verschweigen. "Nur Benjamin, Siegfried Kracauer und Theodor W. Adorno dispensierten sich gelegentlich von dieser – vom Selbsterhaltungs-Interesse diktierten – Strategie des Beschweigens. Nicht nur wurde der Horkheimer-Kreis ständig durch das FBI überwacht, sondern treue Diener der Stalin-Kirche lauerten auch in den USA auf „Dissidenten“, die von der linientreuen Presse diffamiert wurden und deren Leben, sofern sie von einiger Bedeutung schienen, von GPU-Killern bedroht war." (Dahmer)
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 15356
Wie standen die Hauptvertreter der ‘Frankfurter Schule’ zum Protest von ‘1968’? Viele der oppositionellen Studierenden beriefen sich seinerzeit auf die Analysen der Dialektik der Aufklärung, auf Aufsätze Horkheimers aus der Zeitschrift für Sozialforschung oder auf Beiträge von Herbert Marcuse und forderten zugleich von den als ‘Vordenkern’ betrachteten Philosophen ein hohes Maß an Solidarisierung und Identifikation mit ihren Aktionen ein. Horkheimer und Adorno waren nicht bereit, dies bedingungslos aufzubringen und bekundeten das auch öffentlich. Daraufhin brachen Teile der studentischen Protestbewegung mit ihnen. In der Mainstream-Presse in Deutschland war – nach Adornos plötzlichem Tod nach einem Herzinfarkt am 6. 8. 1969 – sogar von ‘Vatermord’ die Rede. War nun 1967/68 eine von der ‘Frankfurter Schule’ beeinflusste ‘Neue Linke’ an den deutschen Universitäten angekommen oder beendete umgekehrt die Konjunktur des Protests die kurze Phase einer Breitenwirkung der ‘Kritischen Theorie’? Für beides lassen sich Belege finden.
- Details
- Geschrieben von: Ulrich Weigel
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 10407
Kritische Anmerkungen zu „Die Idee des Sozialismus“ von A. Honneth
Axel Honneth hat sich die ehrenwerte Aufgabe gestellt, die angestaubte Idee des Sozialismus zu rekonstruieren und mit neuer Attraktivität zu versehen.
Er will den vom frühen Industrialismus geprägten Sozialismus „modernisieren“ und in einem neuen gesellschaftstheoretischen Rahmen fundieren. Sein derart revidierter Sozialismus bricht grundlegend mit jenen Inhalten, die das „alte Modell“ ausgezeichnet haben. Radikale Veränderung der kapitalistischen Eigentums- und Wirtschaftsordnung, politischer Klassenkampf mit dem Ziel, die bürgerliche Ordnung zu stürzen sowie das Proletariat als Subjekt des Wandels werden als obsolet angesehen. Im Honnethschen Modell werden neu die bürgerlichen Institutionen und Mentalitäten als zeitgemäße Materialisierung der sozialistischen Idee, die als soziale Freiheit firmiert, vorgestellt.
- Details
- Geschrieben von: Björn Oellers
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 12399
Die Deutung des Nationalsozialismus im Diskussionskreis des Instituts für Sozialforschung
Teil 2
Im zweiten Teil Horkheimers Analyse des Faschismus und ihre Voraussetzungen zeigt Björn Oellers nun, dass auch in den Beiträgen Horkheimers für die Zeitschrift für Sozialforschung das traditionelle Verständnis des Marxismus zum Tragen kommt. Obgleich Horkheimer in seiner Antrittsvorlesung die neue Programmatik des Instituts entwirft, ist gleichwohl noch eine inhaltliche Kontinuität zur Praxis unter dem vorausgegangenen orthodox-marxistischen Institutsleiter Grünberg festzustellen.
- Details
- Geschrieben von: Helmut Dahmer
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 10603
Der Essay stellt die Entwicklung der politischen Psychoanalyse Reichs dar. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren von 1927 bis 1937. Dazu aus dem Text (S. 5 f.):
„Reichs politische Aktivität wurde ausgelöst durch die Wiener Juli-Ereignisse des Jahres 1927. Die Polizei schoß damals auf führungslos demonstrierende Arbeitermassen, die gegen den Freispruch faschistischer Terroristen protestierten. Reich war nicht nur „sympathisierender Intellektueller“, sondern aktives Mitglied der KPÖ und der KPD, beteiligte sich an Demonstrationen und an riskanteren politischen Unternehmungen, ehe er in den Jahren 1931/32 seine sexualpolitische Arbeit im Rahmen der KPD-Kultur- und Jugendorganisation in großem Stil realisieren konnte.
- Details
- Geschrieben von: Paul Stegemann
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 10784
Die Deutung des Nationalsozialismus im Diskussionskreis des Instituts für Sozialforschung
Teil 1
Im ersten Teil Die Frühphase des Instituts für Sozialforschung und die Krise des Marxismus stellt Paul Stegemann die Arbeit des Instituts nach dessen Gründung und das durch Grünberg vertretene traditionelle Verständnis des Marxismus dar.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 10533
Helmut Dahmer, Soziologe und Psychoanalytiker, ist einer der wenigen kritischen Theoretiker, der die Umwandlung der kritischen Theorie der Gesellschaft zur Theorie kommunikativen Handelns (J. Habermas) und unkritischen Theorie sozialer Anerkennung (A. Honneth) nicht mitgemacht hat. Er erblickte darin (zu Recht) die Aufgabe des kritischen Paradigmas der von Habermas und Honneth so genannten „alten kritischen Theorie“ (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Löwenthal, Neumann etc).
- Details
- Geschrieben von: Felix Perrefort
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 16176
Zur Verteidigung Frantz Fanons „Schwarze Haut, weiße Masken“ gegen die Ideologie der Critical Whiteness
Der folgende Text widmet sich der psychoanalytischen und materialistischen Analyse der historisch bedingten und sich auf beiden Seiten in der Psyche manifestierenden Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen, wie sie Franz Fanon in dem Buch „Schwarze Haut, weiße Masken“ vorgelegt hat. Zunächst wird Fanons Haltung zur Aufklärung dem Antimodernismus der Critical Whiteness gegenübergestellt, dann das neurotische Verhältnis genauer bestimmt. Danach wird Fanons begriffliches Verhältnis zwischen Antisemitismus und Rassismus dem antisemitischen Charakter des Rassismusbegriffs der Critical Whiteness entgegen gesetzt. Zum Schluss versucht der Autor, einen Rassismusbegriff auf der Grundlage der „Dialektik der Aufklärung“ (Adorno/Horkheimer) zu skizzieren.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 14437
Die teils miteinander konkurrierenden, teils zueinander komplementären Nietzsche-Bilder Adornos und Horkheimers werden in chronologischer Reihenfolge skizziert und auf ihren Kreuzungspunkt in der Dialektik der Aufklärung (1947) bezogen. Der Aufsatz zeigt, inwiefern diese unterschiedlichen Einschätzungen Nietzsches ihren Teil zu der inneren Spannung dieses Buches beigetragen haben.
- Details
- Geschrieben von: Ottmar Mareis
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 23511
Axel Honneths Kritik der kritischen Theorie
Wer die kritische Theorie kennt und wegen ihrer rücksichtlosen Kritik gegen das bestehende Falsche schätzt (wie der Autor dieser Zeilen es tut), für den muss Honneths Buch "Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Theorie" (Frankfurt/M.1986) ein einziges Ärgernis sein. Mit ihm bescheinigt er sich selbst, wie der Titel des Buches schon andeutet, ein höheres Reflexionsniveau als der kritischen Theorie der Gesellschaft von Horkheimer und Adorno, die Gegenstand seines, von Ressentiment getrübten Verrisses dieser Theorie ist. Es entstellt und verzerrt die kritische Theorie, dass es dem Kenner die Sprache verschlägt. Kaum ein wahres Wort enthält dieses Buch über die kritische Sozialforschung Horkheimers und Adornos. Und wenn doch einmal ein wahres Wort fällt, so dient es nur der Rationalisierung des Bannspruchs ‚unfähig zur Gesellschaftsanalyse’, mit dem Honneth die kritische Theorie der Gesellschaft aus der sozialwissenschaftlichen Fakultät ein für allemal verbannen möchte. Um die Verbannung durchzusetzen, setzt Honneth die Legende in die Welt, die kritische Sozialforschung sei gar keine echte Sozialforschung, weil gerade das Soziale, das die Sozialforschung zu erforschen habe, seit der „Dialektik der Aufklärung“ (1944) in der kritischen Theorie der Gesellschaft gar nicht mehr und in den Anfangsjahren der kritischen Theorie auch nur sehr rudimentär vorkäme.
- Details
- Geschrieben von: Gregor-Sönke Schneider
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 8865
Schneider illustriert in seinem Aufsatz Leo Löwenthals Beitrag an der Konzeption der Kritischen Theorie am Beispiel der Zeitschrift für Sozialforschung, das über zehn Jahre Publikationsorgan des Instituts für Sozialforschung war. In der Geschichte des Instituts sei die Rolle Löwenthals in der Zeitschrift bisher nur angedeutet worden und insbesondere sein Beitrag zur Konzeption einer Kritischen Theorie bleibe dabei auf der Strecke.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 11807
"In der Rezeptionsgeschichte Adornos in Deutschland haben Zerrbilder eine nicht geringe Rolle gespielt. Besonders in Nachrufen im Jahr seines Todes (1969) und in Artikeln anlässlich seines hundertsten Geburtstags (2003) finden sich schräge Vergleiche, unbeholfene Vereinnahmungen und mit Spott oder Häme untermischte Kommentare zu seinem Werk. Adorno selbst hat in einem Brief aus seinem letzten Lebensjahr an Herbert Marcuse geklagt, von dem Hass, der sich hierzulande auf Habermas und ihn selbst richte, mache Marcuse sich keine Vorstellung.
- Details
- Geschrieben von: Norbert Rath
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 11445
Aspekte von Adornos Konzept des Glücks
Adorno spricht in seinen Schriften von einem universalen ungeschmälerten Glück aller und des Ganzen. Allerdings ist dieses utopische Glück noch nicht da, wird verbogen durch die "Ohnmacht" des Subjekts in der zu einer "zweiten Natur versteinerten Gesellschaft" (Adorno). Surrogate für Glück, wie sie die Kulturindustrie bietet, lehnt Adorno ab.
- Details
- Geschrieben von: Hans-Peter Büttner
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 11449
Darstellung und Kritik der Idee der Diskursethik[1] Karl-Otto Apels
Der Aufsatz Hans Peter Büttners hat zwei Teile. Im ersten Teil (§1- §20) stellt er in Anlehnung an Apels Transzendentalpragmatik zunächst die drei grundlegenden Paradigmen der abendländischen Philosophie dar: (1) das ontologische, (2) das mentalistische (bewusstseinsphilosophische) und schließlich (3) das linguistische (sprachphilosophische) Paradigma. Dann stellt er die für diesen Teil des Aufsatzes zentrale Frage auf, ob und wie die moderne, wissenschaftlich-technische Welt zu einer universalistischen Vernunftethik finden kann, der jeder vernunftbegabte Mensch unter strikter Verwendung seiner vernunftgeleiteten Urteilskraft zwanglos zustimmen kann.
- Details
- Geschrieben von: Stefan Zenklusen
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 18268
Zenklusen geht im folgenden Text der Frage nach, was Adornos und Derridas Philosophie eint und unterscheidet. Dabei steht, was beide unvereinbar unterscheidet, im Vordergrund seiner Untersuchung. Denn der Autor möchte dadurch, dass er das Bewusstsein für das Trennende weckt, der „ negativen Dialektik“ zur Resurrektion verhelfen.
Zenklusens Untersuchung zeitigt abgründige Differenzen zwischen der „negativen Dialektik“ Adornos und der Philosophie der Dekonstruktion Derridas, die oberflächliche Leser Derridas überraschen können, weil Derridas Begriffe auf den ersten Blick ein große Ähnlichkeit mit denen Adornos aufweisen. Unter anderen stellt Zenklusen folgende Unterschiede heraus:
- Details
- Geschrieben von: Helmut Dahmer
- Kategorie: Kritische Theorie als Paradigma
- Zugriffe: 8927
„In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es drei Versuche, vom positivistischen Mainstream abzuweichen und die Selbstreflexion – die Dialektik von Objektivierung, Entfremdung und Wiederaneignung – für das Verständnis der Lebens-, Sozial- und Kulturgeschichte fruchtbar zu machen“, schreibt Dahmer in dem folgenden kurzen Essay. Es sind die Versuche von Marx, Nietzsche und Freud, die alle „Erben Ludwig Feuerbachs“ gewesen seien.
Dann erläutert Dahmer kurz und bündig die qualitative Differenz zwischen den positivistisch verfahrenden Naturwissenschaften und den „unnatürlichen Wissenschaften“ (Nietzsche), die es mit „Objekten“ zu tun haben, die eigentlich Subjekte und als solche in der Lage sind, auf Befunde, die sie selbst betreffen, zu reagieren.
Heinz Gess
- Geld als gesellschaftliche Synthesis und Denkform
- Interview zum Thema "Kritiknetz - Zeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft"
- „…der Riß der Welt geht auch durch mich, gerade durch mich“
- Restitution einer Kritischen Theorie
- Im Zeitalter Globaler Gleichzeitigkeit. Kritische Theorie der Gegenwart
- Die Läuterung der kritischen Theorie der Gesellschaft durch den kritischen Kritiker Axel Honneth
- Geduld und Theorie Ein Versuch über die gegenwärtige Lage und die Aufgaben von Theorie und Politik
- Massenloyalität. Zur Aktualität der Sozialpsychologie Peter Brückners
- Horkheimer und Adorno: Differenzen im Paradigmakern der Kritischen Theorie
- Luhmann und Sohn-Rethel
- Telosrealisation oder Selbsterzeugung der menschlichen Gattung?
- Der Begriff des Glücks bei Adorno
- Karl Marx als Philosoph der menschlichen Emanzipation
- "... Was kritische Theorie eigentlich ist." Eine Einladung
- Soziale Amnesie: Worum geht es in der ‚Integrationsdebatte’?
- Adorno - mon amour! Zur Dialektik der 68er
- Max Horkheimers Sicht der "traditionellen und kritischen Theorie "
- Horkheimers Kritik der instrumentellen Vernunft
- Kritische Theorie - Was ist das?
- Marcuse über den "Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung"
- Freiheit und Gleichheit als sachlich vermittelte Herrschaft
- Gegengift. Thesen gegen Okkultismus
- Religion, Verantwortung und Emanzipation
- Manifest der emanzipatorischen Linken
- Individualismus. Zur Kritischen Theorie der Individualisierung
- Die fromme Idee der Arbeitsgesellschaft
- Identity is the very devil
- Was heißt und zu welchem Ende betreiben wir Kapitalismuskrtik
- Kritik des Verhältnisses von Arbeit und Interaktion bei Jürgen Habermas
- Horkheimer über den "Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philosophie"
- Holloways "Open Marxism"
- Die kritische Theorie des Kapitalismus neu überdenken
- Die Fortschrittsillusion in der Neuropsychologie, die Liquidation des Individuums in der modernen Gesellschaft und der Verfall der universalistischen Moral
- Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideologie
- Das Verhältnis des Theoretikers zur Bewegung
- Adornos Messer
- Postmodernes New Age und die kritische Theorie der Gesellschaft
- Der »Neue Mensch« als Ideologie der Entmenschlichung
- Mensch und Tier
- Die Praxis und das Begreifen der Praxis
- Über den Missbrauch der kritischen Theorie und ihres Namens im "Institut für kritische Theorie" (Inkrit; W.F. Haug)
- Antinomie der Freiheit. - Zur Dialektik des Liberalismus
- Zur Kritik des Identitätsbegriffs
- Für eine Kritische Theorie der Medien
- Klassenkampf: Kommunismus oder Anstachelung zum Amoklauf?
- Herrschaft, die "Sinn schafft" (Nietzsche), oder Emanzipation von Herrschaft?
- Freiheit und Gleichheit als sachlich vermittelte Herrschaft