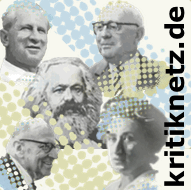Vilém Flusser: „Ich lebe so oft, wie ich durch Vernetzung an Verknotungen teilnehme“
Es ist ruhig geworden um Medientheorie. Aus der Bundesrepublik, einstmals „Epizentrum der Medien- und Kommunikationstheorie“ (Hans Ulrich Gumprecht), ist nach dem diskursiven Versiegen postmoderner Theoriebildung kaum noch etwas zur Zukunft und zum Wirken der Medien mit jenem Eifer zu hören, wie er in den 1980er und 1990er Jahren – ausgehend von Frankreich – usus war. Eine der zentralen Topoi postmoderner Theorie war die Überzeugung, dass das Bewusstsein seinen Systemverbund aus biologischem Hirn, nervöser Elektrik und körperlicher Eingebundenheit verlässt („Exteriorität des Geistes“), um sich (in) anderen Systemverbänden ‚auszustellen’/ (auszusetzen) – apparative hardware und „symbolische“ software –; und dass es sich bei dieser Auswanderung nicht einfach nur um Auslagerung, um Erweiterung des Bewusstseins handelt, sondern um einen neuen Systembereich – mit einer impliziten, exklusiv eigenen, unreduzierbaren „Logik“ der Technisierung.
Der folgende Essay versucht, ausgehend von einem Satz Vilém Flussers, noch einmal Revue passieren zu lassen, was aus theoretischen Sichten zur Vergesellschaftung von Technologie noch zu destillieren ist, aus Sichten also, die im Nirgendwo zwischen verschwundenem Subjekt, bewusstlosem user und kapitalistischer Barbarisierung ihren Ausgang genommen hatten. Der Versuch ist grundiert in der Überzeugung, in der unendlichen Ödnis gegenwärtiger Elektronifizierung resp. Technologisierung doch noch etwas ausmachen zu können, was früher einmal mit dem Umsprung von Quantität in Qualität dialektisch eingeholt wurde.
Bernd Ternes
Wenn Sie den Essay lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .