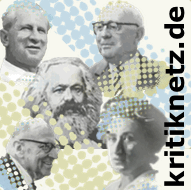Herbert Marcuses Kritik des Politischen Existentialismus
Die Schriften des jungen Marcuse bis Ende der zwanziger Jahre gehören zu jenen Werken, die in heutiger Zeit unter dem Begriff „Heidegger-Marxismus“ subsumiert werden. Was der frühe Marcuse sich aus der von ihm abgestrebten Synthese von Marx und Heidegger erhoffte, war eine grundlegende philosophische Korrektur des zum Dogma gewordenen deterministischen Marxismus. Demzufolge werde die Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft durch die sozialistische und kommunistische mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes eintreten (s. Engels Aufsatz über die „Dialektik der Natur“). Menschliches, politisches Handeln aus Freiheit habe deshalb nur die Möglichkeit, den beschwerlichen Weg der Transformation abzukürzen und so zu gestalten, dass das unvermeidliche Leiden der Transformation – Pogrome, Kriege, Zerstörungen – möglichst gemildert würde.
Marcuse erkannte jedoch, dass die gesellschaftliche Revolution, die alle Verhältnisse umwälzen soll, unter denen die meisten Menschen geknechtet und entwürdigt bleiben, nicht durch Determinismus garantiert, sondern von der Entscheidung der Subjekte abhängig ist, die unter diesen Bedingungen leiden. Um den dogmatisch erstarrten Marxismus zu überwinden, griff Marcuse auf Heidegger zurück. Durch Rückgriff auf Heideggers Existenzialontologie wollte er den ursprünglichen Gehalt der historischen Dialektik freilegen.
Dieser Rückgriff erwies sich jedoch bald als Fehlschlag, wie Marcuse selbst einsah. Ein erstes Ergebnis dieser Einsicht ist sein Aufsatz „Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung“ (vgl. https://www.kritiknetz.de/kritischetheorie/255). Der Irrtum beruhte auf einer Fehldeutung von Heideggers frühen Schriften, insbesondere von Sein und Zeit, die durch die systematisch mehrdeutige Sprache Heideggers begünstigt wurde.
Wie es zu dieser Fehldeutung kam, ist Gegenstand des folgenden Textes von Rickermann. Er verfolgt dieses Ziel in zwei Schritten: Zunächst analysiert er Heideggers Daseinsanalyse und dessen Begriff der Geschichtlichkeit. Im zweiten Schritt stellt er Marcuses immanente Kritik an Heidegger dar, die mit einem Abschnitt über „das Problem Heidegger“ abschließt. Aus dieser Kritik zieht Rickermann den Schluss, dass das scheinbar „aktivistische Moment“ der bürgerlichen Philosophie bereits ihre bürgerliche Antibürgerlichkeit ankündigt: Der Weg der Philosophie zum konkreten Dasein ist nur um den Preis der Aushöhlung ihres Vernunft- und Freiheitsanspruchs möglich.
Marcuses Enttäuschung über Heidegger und deren Verarbeitung eröffnete ihm schließlich die Einsicht in das Wesen jener neuen faschistischen Mentalität, die den Untergang der liberalen Phase des Kapitalismus begleitete.
Heinz Gess
Wenn Sie den Beitrag von Jan Rickermann lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .