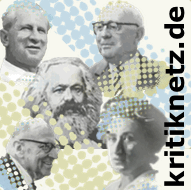Die Erfahrung, dass unsere Welt ständig durch technisch stets effizientere, profitabel verwertbare Arbeit verändert wird, dass immer neue technische „Revolutionen“ einander folgen, hat dazu geführt, dass die nicht-technischen Praktiken der Weltveränderung – Kritik, Kunst und Revolution – entwertet wurden und in Vergessenheit geraten sind.
Vor hundert Jahren, Ende Oktober 1924, veröffentlichte der 28jährige Dichter André Breton (1896-1966), der in Paris einen Kreis ähnlich denkender Künstler-Freunde um sich geschart hatte (Aragon, Éluard, Naville, Péret, Soupault und andere), sein (Erstes) Manifest des Surrealismus. Auf gut dreißig Druckseiten umriss er das Projekt seiner Gruppe, das missachtete und vergessene Potential des Traums und der Imagination gegen die von kalkulatorischer Vernunft durchherrschte gesellschaftliche Wirklichkeit der Kriege, des Massenelends und der Naturverwüstung aufzubieten.
Lyrische Dichtungen, Erzählungen und Romane, Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen sollten im Jahrhundert erhoffter Revolutionen – als Zeugnisse einer neuartigen, in der Kunstgeschichte noch kaum erprobten Freiheit der Techniken, Formen und Sujets – die schlummernden Phantasien und kreativen Potentiale unterdrückter Massen wecken.
Die Generation der späteren Surrealisten war 1914 knapp 20 Jahre alt. Der Weltkrieg beendete ihre Jugend. Ihre Antwort war eine Kriegserklärung an diese Wirklichkeit. Eine internationalistisch orientierte Künstlerbewegung, die sich als Teil der antikapitalistisch-antibürokratischen Revolution verstand und das dreifache Ziel verfolgte, „die Welt zu verändern, das Leben zu ändern, die Verständigung unter den Menschen neu zu begründen“ (Breton), eine Bohème-Organisation, die, um der Freiheit des individuellen Ausdrucks willen, ihre Unabhängigkeit auch gegenüber Organisationen wahrte, die als „Partei der Freiheit“ firmierten, hat es weder vor, noch nach den Surrealisten gegeben. Was da, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, als Möglichkeit aufleuchtete, harrt, wie andere Verheißungen des Surrealismus, noch seiner Stunde.
Der Surrealismus war die vorläufig letzte Revolte nonkonformistischer Künstlerinnen und Künstler und ihrer Kunst gegen die bestehende Gesellschaft. Er ist ebenso inaktuell wie uneingelöst, und eine neuerliche Emeute der internationalen Artistinnen und Artisten ist so wünschbar wie ein neuerlicher Versuch der abhängig beschäftigten und unbeschäftigten Bevölkerung West- und Osteuropas, jenes Schicksal zu sabotieren, auf das die Renditenwirtschaft unter Ägide ihrer Profiteure – der Oligarchen, Krisenverwalter und nuklearen Apokalyptiker – zutreibt. (H. Dahmer)
Wenn Sie den Beitrag von Helmut Dahmer lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .