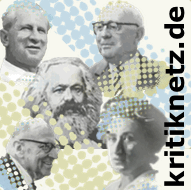Progressive Waren als Subjektformen im Nachgang zu Marx und Prokop
"Die Erkenntnis der Verdinglichung der Gesellschaft (darf) nicht ihrerseits wieder so verdinglicht werden, daß kein Gedanke überhaupt gedacht werden darf, der aus dem Bannkreis der Verdinglichung heraustritt" (Adorno)
Dieser Satz Adornos ist der Leitgedanke des folgenden Essays von Bernd Ternes.
Bernd Ternes geht davon aus, dass der lebensweltliche Bereich sprachlich-symbolischer Interaktion, auf dessen dialektische Spannung im Verhältnis zur „Systemwelt“ die postkritische Gesellschaftstheorie ihre Hoffnung setzte, als diejenige Kraft, die die Tür zur menschlichen Emanzipation offenhalten sollte, nicht die erhoffte kraftvolle dialektische Spannung zu Systemwelt entwickeln konnte und die Hoffnung darauf trog.
Statt in dem lebensweltlichen Bereich sprachlich-symbolischer Interaktion sieht er diese Kraft und dialektische Spannung in der kapitalistischen Produktionsweise und Warenzirkulation selbst bzw. dem, was Habermas die „Systemwelt“ nennt, sich entwickeln, also dort, wo Verdinglichungs- und Lebensweltentkopplungsprozesse dominant sind: in der technisierten Lebenswelt und in den entsprachlichten Kommunikationsmedien.
Der Prozess sei, so Ternes, allerdings zwiespältig, ambivalent und widersprüchlich. Die Zwiespältigkeit kennzeichne, dass eben das, was zu einer positiven Aufhebung der Verhältnisse beitrage könne, innerhalb dieser Verhältnisse selbst zur Destruktion führt. Diese Sichtweise habe Peter Brückner in seinem Buch "Sozialpsychologie des Kapitalismus" vorsichtig wieder in den Denkbereich der Dialektik gerückt - als mögliches Potenzial der Emanzipation. Unter der Voraussetzung, dass sich der Klassencharakter der Gesellschaft sich erneut manifestierte, sei die Möglichkeit gegeben, dass sich unter den technokratisch organisierten Menschen etwas verändert: das „Nicht-Sozialisierte der Psyche [lässt sich] nach vernünftigen Prinzipien solidarisch organisieren und wird dann ansatzweise zu transformativer Energie. Die psychischen Systeme werden ‚heiß’.“
Dieter Prokop habe 20 Jahre später in seinem Aufsatz "Freiheitsmomente kulturindustrieller Warenform: Identitätsdarstellung in der Nichtidentität" (2003) diese Redialektisierung nochmals geschärft durch Hinweise auf das Gestaltungsvermögen der Menschen im kulturindustriellen Orbit. Er greife den Gedanken des Aufbrechens transformativer Power bei Brückner wieder auf, aber er stelle dieses Aufbrechen weniger als Bruch, sondern als Strategie der Menschen dar, selbstbewusst Nicht-Identität zu leben, so dass eine dialektische Spannung im Sozialcharakter wirksam sei.
Heinz Gess
Wenn Sie den Beitrag von Bernd Ternes lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .