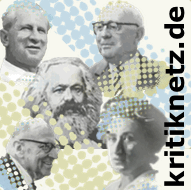Zu Stefan Franks Kritik der Marx'schen Kritik der Politischen Ökonomie
Hans Peter Büttner setzt sich in folgendem Essay kritisch mit Stefan Franks postmoderner Revision der „Kritik der politischen Ökonomie ( „Von Bibern und Hirschen“, in Konkret 10/2014) auseinander. Er schreibt: "Franks Ausführungen stellen den Versuch einer Kritik der Marx’schen Werttheorie, der Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate und anderer Bestandteile des Marx’schen Forschungsprogramms dar; jedoch scheitert der Versuch bereits im Ansatz, da der Autor nachweislich nicht in der Lage oder Willens ist, elementare theoretische Aussagen der Kritik der Politischen Ökonomie adäquat zu erfassen.“
Frank stellt heraus, dass zwischen dem dritten Band des Kapitals, in dem Marx den "Gesamtprozess der kapitalistischen Produktionsweise" darstellt, und dem ersten Band, der idealtypisch reduzierte Grundkategorien entwickelt, um diesen Gesamtprozess später in seiner Gesamtkomplexität darstellen zu können, Ungereimtheiten bestehen, die Marx selber nicht vollständig aufgelöst habe. Die Ungereimtheiten entstehen dadurch, dass bei der Darstellung des in sich vermittelten Gesamtprozesses die zu Beginn entwickelten Kategorien relativiert werden. Das nimmt Frank zum Anlass, die Wertkritik von Marx zur Gänze zu verwerfen. Dagegen wendet sich Büttners Kritik. Büttner zeigt auf, dass die Gründe, die Frank für die Verwerfung der kritischen Werttheorie von Marx anführt, unzutreffend sind, weil sie an der Sache selbst, der apriorischen Selbstzweckbewegung des „abstrakten Reichtums“, vorbeigehen. Das liegt daran, dass Stefan Frank handlungstheoretisch und methodologisch individualistisch ohne Bezugnahme auf die negative Systemtotalität des Kapitals argumentiert. Aus einer solchen Perspektive aber lassen sich die Systemkategorien „Kapital“, „Wert“/“Geld“, „abstrakte Arbeit“, d. s. die Realkategorien, die die funktional differenzierte systemische Totalität im Innersten zusammenhalten, bis die Bewegung des Kapitals an ihre immanenten Schranken stößt, nicht begreifen. Auf der Ebene der Einzelkapitale und Waren erscheint die kapitalistische Veranstaltung zwar so, als sei sie eine handlungstheoretisch annähernd erfassbare, in subjektiven Kalkülen aufgehende Veranstaltung, in der sich Akteure unmittelbarer Interessen gegenüberstehen, aber das, was die Akteure in ihrem gesellschaftlichen Sosein selbst konstituiert, der Bedingungsgrund der realen Verwertungsbewegung, ihre zwingende Objektivität im „falschen Ganzen“ (Adorno) lässt sich nicht auffassen. Von diesem wirklichen komplexen Vermittlungszusammenhang, dem in sich vermittelten Ganzen der fetischistischen Kapitalbewegung, ist im dritten Band des Kapitals die Rede, indes der erste Band noch seinen Ausgang nimmt von der idealtypisch reduzierten „Elementarform“ des „abstrakten Reichtums, nämlich der einzelnen Ware im Austausch mit anderer einzelner Ware und eben darum das Ganze auch nur in „idealtypischer“ Einfachheit, also unterkomplex, darstellen kann. In Worten von Robert Kurz: „Die von Marx theoretisch dargestellten Realkategorien des Kapitals sind von Anfang an und auf allen Ebenen der Darstellung nur als Kategorien des gesellschaftlichen Ganzen, des Gesamtkapitals und seiner Gesamtbewegung zu verstehen, die unmittelbar empirisch nicht erfasst werden kann, weil sie qualitativ und quantitativ gleichermaßen etwas anderes ist als die empirische Bewegung der Einzelkapitale. Letztere jedoch ist es allein, die für die Akteure praktisch erscheint, während die wirkliche Bewegung des realen Gesamtkapitals empirisch nur indirekt erfassbar ist an ihren gesellschaftlichen Wirkungen (vor allem in den Krisen).“[1] Genau dieses Problem ist es, das Stefan Frank nicht erkennen kann oder will. Dazu müsste er über den Schatten springen, den sein methodologischer Individualismus wirft.
Heinz Gess
Wenn Sie den Essay lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .
[1] Robert Kurz, Geld ohne Wert, Grundrisse einer Transformation der Kritik der Politischen Ökonomie, Berlin 2012, S. 177