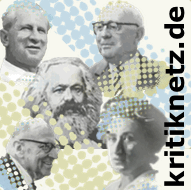-Umrisse einer Bestandsaufnahme; Skizzen zu Kritik, Alternativen und Perspektive-
Das Bildungswesen stellt ein gesellschaftliches Bezugsfeld dar, das seit über einem Jahrzehnt den machtvollen Vereinnahmungsversuchen durch betriebswirtschaftliches Gedankengut kaum mehr zu widerstehen vermag. Als Ursachen dieser Entwicklung sind sowohl eine sich verselbständigende Systemdynamik wie auch zielgerichtetes, d.h. politisches Handeln des Menschen namhaft zu machen.
Die Überführung gesellschaftlicher Subsysteme, die bislang nicht vorwiegend am Prinzip ökonomischer Rationalität orientiert waren, in Bereiche der Marktförmigkeit wird in internationaler Hinsicht durch das GATS, ein von der WTO organisiertes Handelsabkommen, mit Nachdruck befördert.
Die bekannten reformideologischen Begriffe wie z.B. „autonome Schule“, „lernende Institution“ und „Eigenverantwortlichkeit“ begleiten und verschleiern den Prozess der merkantilen Ausrichtung von Schule und Universität gleichermaßen. Die zumeist Fortschrittlichkeit und Modernität suggerierenden Konnotationen der genannten Schlagworte täuschen in der Regel über deren Anfälligkeit für Instrumentalisierung durch Interessenkonstellationen, die auf ökonomischen Nutzen und die damit letztlich verbundene Systemstabilisierung abzielen, geschickt und unauffällig hinweg.
Ein längst ins Schlepptau expandierender Wirtschaftsinteressen geratener und infolgedessen unverkennbare Degenerations- und Deklassierungsspuren aufweisender Bildungsbegriff spielt den in der gegenwärtigen bundesrepublikanischen Gesellschaft ohnehin vorhandenen Entfremdungsprozessen in die Hände: Desintegration und Devianz mit steigender Tendenz erweisen sich als Auswirkungen einer sozial- sowie kulturpolitischen Entwicklung, in der Bildung ihren Anspruch auf humanisierende, ausgleichende Wirkung einbüßt.
Den „Herrschaftsanspruch“ der auf Verwertbarkeit und Markttauglichkeit ausgerichteten Komponente von Bildung nicht unerheblich zu reduzieren, stellt eine Aufgabe dar, deren Verständnis allen am Bildungswesen Beteiligten Wirklichkeitssinn und Theoriebewusstsein zugleich abverlangt. In praktischer Hinsicht dürfte es geboten sein, dass den Menschen insbesondere von der offiziellen Bildungspolitik über die entsprechenden Instanzen und Institutionen wesentlich mehr Chancen, an der Wissenskonstruktion zu partizipieren, eingeräumt werden.
Michael Pleister
Wenn Sie den interessanten kritischen Text von Michael Pleister über "Bildung" als bloßer Effekt marktliberaler Anpassung weiterlesen wollen, dann klicken Sie bitte h i e r (203.91 KB)