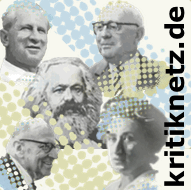Darstellung und Kritik der Idee der Diskursethik[1] Karl-Otto Apels
Der Aufsatz Hans Peter Büttners hat zwei Teile. Im ersten Teil (§1- §20) stellt er in Anlehnung an Apels Transzendentalpragmatik zunächst die drei grundlegenden Paradigmen der abendländischen Philosophie dar: (1) das ontologische, (2) das mentalistische (bewusstseinsphilosophische) und schließlich (3) das linguistische (sprachphilosophische) Paradigma. Dann stellt er die für diesen Teil des Aufsatzes zentrale Frage auf, ob und wie die moderne, wissenschaftlich-technische Welt zu einer universalistischen Vernunftethik finden kann, der jeder vernunftbegabte Mensch unter strikter Verwendung seiner vernunftgeleiteten Urteilskraft zwanglos zustimmen kann.
Seine Antwort auf diese Frage lautet: Eine allgemeingültige universalistische Ethik kann nur die Gestalt der Diskursethik haben. Denn das „Apriori der Argumentation“ sei das „Nadelöhr“, durch welches alle Vernunftansprüche hindurch müssen. Daran könne kein Wissenschaftler irgendeiner Wissenschaftsdisziplin, aber auch niemand sonst vorbei, der für sich in Anspruch nimmt, eine Aussage zu einem beliebigen Gegenstand vernünftig zu begründen. Anschließend untersucht der Autor - nach einem Exkurs über die vom Kritischen Rationalismus (Popper, Albert) ausgearbeitete Kritik von „Letztbegründungen“ normativer Setzungen - das „Apriori der Argumentation“ in Anlehnung an Apels Transzendentalpragmatik genauer und expliziert die normativen Regelelemente, die in sich argumentative Begründungsstrukturen enthalten. Diese Implikate der argumentativen Logik fasst er in 8 Grundnormen zusammen.
Im zweiten Teil (§20 - §25) kritisiert der Autor Apels Diskursethik und stellt als ihr Manko heraus, dass sie nicht hinreichend auf die den Diskursen vorgelagerten bzw. von ihnen immer schon vorausgesetzten Bereiche der materiellen Reproduktion des Lebens reflektiere. „Apel reflektiert nicht hinreichend auf jene subjektlosen Sachzwänge des Kapitalverhältnisses, welche die Idee einer freien und vernünftigen Verständigung über gesellschaftliche Angelegenheiten systematisch unterminieren.(...). Apel selbst ist in der Reflexion auf die materiellen Implikationen seines Ansatzes und die Struktur des Kapitalverhältnisses inkonsequent und überaus naiv. (...) So versichert Apel ohne jedes kritische Bewusstsein, fest auf dem Boden von Staat und Kapital zu stehen und dennoch sein inhaltliches Anliegen nicht aufgeben zu wollen. Er konstatiert, dass "die (...) Ablösung des systemischen Automatismus der auf Warentausch und Konkurrenz beruhenden Marktwirtschaft durch eine irgendwie direkte und für alle Beteiligten transparente Produktions- und Verteilungswirtschaft (...) nicht mehr als Lösung in Betracht kommt."[1] Stattdessen schlägt Apel eine praktische Anwendung seines Ansatzes "im Sinne einer 'sozialen Marktwirtschaft' im Weltmaßstab"[2] vor. Apel geht also allen Ernstes davon aus, dass der von ihm selbst benannte "systemische Automatismus" der Kapitalverwertung sich auf globaler Stufe in ein System "herrschaftsfreier Kommunikation" umformen ließe, ohne dass der „systemische Automatismus“ selbst aufgehoben werden müsse. So reduziert Apel das mögliche kritische Potenzial seines eigenen Ansatzes, um ihn für den globalen Kapitalismus anschlussfähig zu halten und verabschiedet sich unausgesprochen von der Idee einer herrschaftsfreien Gesellschaftsordnung, in der alle als freie und gleiche Produzenten ohne Angst am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können und die moralische Verpflichtung fühlen, sich für materielle Lebensverhältnisse einzusetzen, die eine universalistische Diskursethik ermöglichen. Denn solange die Welt der universalen Konkurrenz herrscht, wären Geschäftsleute ausgemachte Narren, die sich um einer diskurstheoretisch begründeten moralischen Forderung willen ein profitables Geschäft oder sonstigen geldwerten Vorteil entgehen ließen, und Geschäftsleute, Waren- und Geldsubjekte, sind in der voll entwickelten Marktwirtschaft des Kapitals alle. Und dort, wo sie es nicht sind oder sich so inszenieren, beten sie statt den Geldfetisch religiöse Fetische an. Und das ist nicht besser, sonder eher noch schlechter.
Heinz Gess
[1]Überarbeitete und erweiterte Fassung des Manuskripts eines Vortrags vom 21. Mai 2015 im Konstanzer
Bildungszentrum
[1] Apel (1994), S. 37.
[2] Ebd.
Wenn Sie den Beitrag lesen möchten, klicken Sie bitte h i e r .